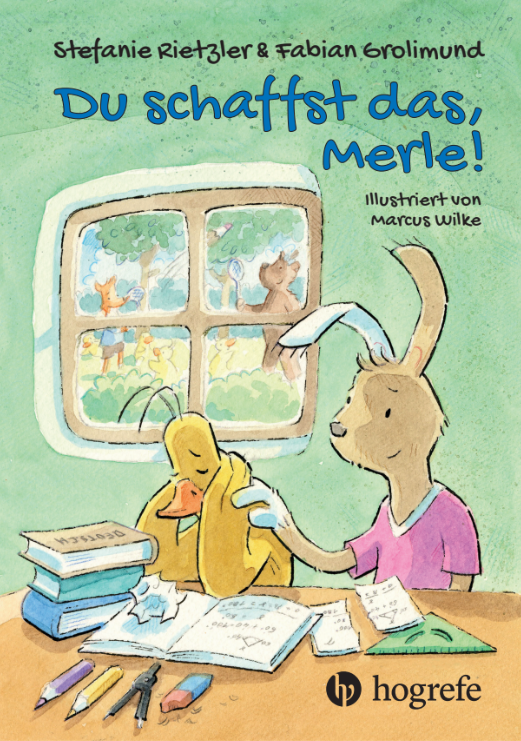"Die gute Note war nur Glück!" - Wenn Kinder sich wie Hochstapler/innen fühlen
"Ich hatte einfach Glück.", "Die anderen sind viel besser als ich.", "Gleich merken sie, dass ich gar nichts kann."
Solche Sätze hört man nicht selten – von Erwachsenen, die beruflich erfolgreich sind und dennoch ständig an ihren Fähigkeiten zweifeln, aber auch von Kindern und Jugendlichen.
Was hier mitschwingt, ist kein einfacher Selbstzweifel – sondern ein tief verankertes Gefühl, Erfolg nicht zu verdienen, nur durch Zufall eine gute Note bekommen zu haben und "eigentlich gar nicht so schlau zu sein". Gute Leistungen führen daher kaum zu Stolz, sondern höchstes zu Erleichterung. Andauernd sitzt diesen Menschen die Angst im Nacken, dass die nächste Leistungssituation sie enttarnen könnte. Dann würden alle sehen, dass sie im Grund gar nichts können und allen nur etwas vorgegaukelt haben.
In der Psychologie bezeichnet man dieses Phänomen als Imposter- oder Hochstapler-Syndrom. Es wurde erstmals 1978 von den Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes von der Georgia State University beschrieben. Sie untersuchten erfolgreiche Frauen, die trotz objektiver Erfolge unter massiven Selbstzweifeln litten (Clance & Imes, 1978). Die Betroffenen glaubten, ihre Leistungen seien durch Glück, Hilfe anderer oder Zufall zustande gekommen – und lebten mit der ständigen Angst, als "Betrügerin" entlarvt zu werden.
Inzwischen weiß man: Dieses Phänomen betrifft nicht nur Erwachsene – und nicht nur Frauen. Auch Kinder und Jugendliche erleben sich manchmal als "Nicht-gut-genug", obwohl ihre Leistungen das Gegenteil zeigen (Kumar & Jagacinski, 2006).
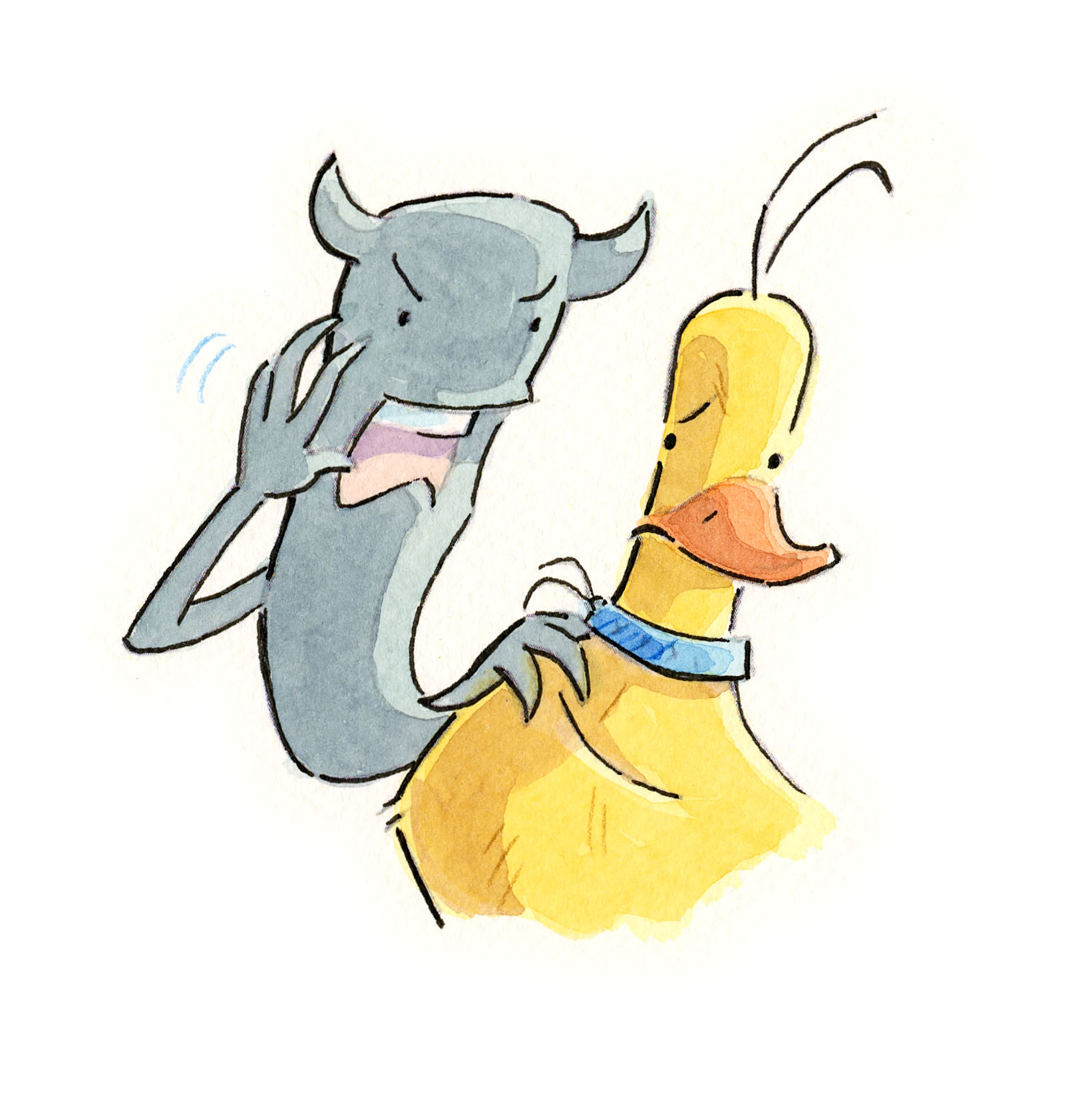
Typisch für Betroffene ist, dass sie:
- sich wenig zutrauen.
- Herausforderungen vermeiden, um nicht zu scheitern oder sich sehr hohe Ziele setzen und extrem enttäuscht reagieren, wenn sie diese nicht erreichen.
- Erfolg herunterspielen und auf äußere Faktoren zurückführen.
- sich selbst stark unter Druck setzen.
- sich oft minderwertig fühlen.
- unter Selbstzweifeln leiden.
- die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen nicht realistisch einschätzen können.
- Angst haben, Erwartungen nicht erfüllen zu können.
- glauben, sich exzessiv auf Prüfungen vorbereiten zu müssen, um ihre mangelnde Intelligenz auszugleichen („allen anderen fällt das viel leichter!“).
Woher kommt dieses Gefühl?
Das Imposter-Syndrom entsteht nicht über Nacht – es entwickelt sich oft über Jahre. Folgende Faktoren können eine Rolle spielen:
- (Angeborene) Persönlichkeitseigenschaften
- Hohe Erwartungen und ein leistungsorientiertes Umfeld: Kinder, die früh als besonders klug oder begabt gelobt wurden, fühlen sich manchmal unter Druck, diesem Bild gerecht zu werden. Jeder kleine Fehler scheint dann ein Beweis dafür zu sein, dass sie "doch nicht so besonders" sind.
- Vergleiche mit anderen: Ein Teil der Betroffenen berichtet von einem Geschwisterkind, das als besonders intelligent oder talentiert bezeichnet wurde, wohingegen sie selbst eher als das „soziale“ oder „brave“ Kind galten. Dies verursachte einerseits ein Gefühl von Minderwertigkeit und anderseits viel Druck, das Urteil des Umfeldes zu widerlegen.
- Parentifizierung: Manche Betroffene berichten, dass sie bereits als Kind die Verantwortung für die Eltern oder jüngere Geschwister übernehmen mussten. Etwa, weil die Bezugspersonen psychisch belastet, suchtkrank oder körperlich eingeschränkt waren oder jüngere Geschwister vernachlässigt haben.
- Soziale Benachteiligung: Studien zeigen immer wieder, dass es für Kinder aus einkommensschwachen und schulbildungsfernen Familien deutlich schwieriger ist, einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Gleichzeitig erleben sie mehr Angst vor Leistungssituationen und das Gefühl, in „akademischen Kreisen“ nicht dazuzugehören.
- Niedriges oder bedingtes Selbstwertgefühl: Kinder, die den Eindruck haben, wenig wert zu sein oder nur dann geliebt zu werden, wenn sie besondere Leistungen zeigen, sind besonders gefährdet, sich als Hochstapler/in zu fühlen.
- Kontrollierender, überbehütender oder vernachlässigender Erziehungsstil: Während ein einfühlsamer Erziehungsstil, der Kindern aber auch Freiheiten lässt und auf Vertrauen setzt, ein wichtiger Schutzfaktor ist, fördert überbehütendes, kontrollierendes oder vernachlässigendes Elternverhalten die Entwicklung des Hochstapler-Syndroms.
- Lob für gute Ergebnisse und Talent: Verschiedenen Studien zeigen, dass Kinder, die in erster Linie für Erfolge, Intelligenz oder Begabung gelobt werden, mehr Angst davor haben, diesen Status wieder zu verlieren und ihre Eltern zu enttäuschen.
- Übermäßiges Lob: Werden Kinder für jede Kleinigkeit gelobt und wird ihnen ständig vermittelt, dass sie etwas Besonderes seien und Dinge besonders gut können, holt sie früher oder später die Realität ein. Stellen sie nun fest, dass sie doch nicht in allem so gut sind und sich nicht jedes Ziel mühelos erreichen lässt, beginnen sie daran zu zweifeln, ob die damaligen Botschaften aus der Familie eine Lüge waren und vielleicht ihr ganzes Selbstbild auf einem Vorspiel falscher Tatsachen beruht.
Wie sich das Imposter-Syndrom abschwächen lässt
Es gibt viele Möglichkeiten, den Leidensdruck betroffener Kinder und Jugendlicher zu reduzieren.
Einige Methoden stellen wir hier vor:
Normalisierung
Die meisten Kinder und Jugendlichen, die sich mit dem Hochstapler-Syndrom herumschlagen, fühlen sich alleine mit ihrer Scham und ihren Ängsten. Gut gemeinte Ermunterungen wie „also du brauchst dir jetzt wirklich keine Sorgen zu machen – du bist doch eh immer gut!“ oder „in der letzten Prüfung hattest du doch auch eine gute Note“ können diese Empfindung verstärken. Die eigenen Sorgen gehen davon nicht weg, sondern werden noch „peinlicher“.
Es ist entlastend für Kinder, wenn sie merken, dass andere Kinder und Jugendliche ähnliches erleben und ihre Bezugspersonen ihnen ein offenes Ohr schenken.
In unserem Kinderroman „Du schaffst das, Merle!“, finden Kinder zwischen 7 und 12 Jahren eine Figur, in deren Gedankenwelt sie sich wiederfinden und die ihnen behutsam einen Ausweg zeigt.
Unbedingte Wertschätzung
Kinder und Jugendliche mit Imposter-Syndrom haben oft den Eindruck, dass ihr Wert fast ausschließlich von ihren Erfolgen und Leistungen abhängt und andere sich enttäuscht abwenden oder sie auslachen würden, wenn sie versagen. Sie brauchen immer wieder die Versicherung: Wir lieben dich und sind für dich da – ganz unabhängig von deinen Leistungen.
Ente Merle trifft in unserem Roman zum Glück auf viele Personen, die ihr zeigen, dass sie mehr ist als ihre Leistungen und auch ein Misserfolg nichts an der Zuneigung zu ihr ändert:
Merle wendet den Kopf ab und flüstert kleinlaut: „Ich muss halt einfach bestehen … wer bin ich denn, wenn ich das nicht schaffe?“ Energisch reibt sie sich mit den Flügeln über ihre brennenden Augen.
Da rollt sich ihre Freundin Lotte zu ihr herüber und sagt: „Wenn du es nicht schaffst, bist du doch immer noch unsere Merle.“
Tief in Merles Brust löst sich ein Schluchzen und schüttelt ihren ganzen Körper durch. Die Tränen laufen und laufen.
Bärin Frieda krault ihr sanft das Gefieder im Nacken: „Unsere Merle ist mehr als so blöde Noten.“
Erschöpft vergräbt Merle den Kopf in Friedas weichem Bärenfell, schluckt den Kloß in ihrem Hals herunter und flüstert: „Es ist gleich Mitternacht. Lotte, erzählst du mal wieder eine Gruselgeschichte?“
Typische negative Denkmuster und Glaubenssätze kennenlernen und hinterfragen
Perfektionistische, leistungsängstliche Menschen tragen oft tiefsitzende negative Denkmuster und Glaubenssätze mit sich herum. Zum Beispiel:
- „Ich bin nicht gut genug!“
- „Irgendwann merken alle, dass ich ein Versager bin!“
- „Ich schaffe das sowieso nicht. Ich bin einfach zu dumm!“
- „Ich darf mir keinen Fehler leisten!“
Relativ unbewusst und automatisiert werden diese Denkmuster in Leistungssituationen aktiviert und rufen Unsicherheit, Angst, Scham, Wut und Frust hervor.
Versuchen ihre Bezugspersonen sie vom Gegenteil zu überzeugen, so verteidigen Kinder und Jugendliche diese Glaubenssätze teilweise vehement.
Damit es ihnen gelingt, sich von diesen Gedanken zu lösen und eine gesündere Haltung zu entwickeln, ist meist eine längere und tiefere Auseinandersetzung nötig.
Manchmal hilft dabei in einem ersten Schritt die Externalisierung des Problems. Dabei werden die negativen Selbstgespräche von der jeweiligen Person getrennt und einer außenstehenden Figur zugeschrieben.
Sehen wir uns dazu ein Beispiel aus „Du schaffst das, Merle!“ an:
Merle lässt die Geige sinken und kneift den Schnabel zusammen: „Das bringt doch eh alles nichts! Ich kriege das alles nicht in meinen blöden Entenschädel! Frau Hermelin hat Recht: ich gehöre sowieso nicht an diese Schule!“
Der Geigenlehrer Nadim mustert sie mit sanftem, ruhigem Blick. Dann nimmt er ihr die Violine aus dem Flügel und verstaut sie im Geigenkasten. „Solch böse Worte sollst du nicht hören, kleine Geige“, flüstert er dem Instrument zu, als er den Deckel schließt.
Plötzlich fixiert Nadim die Ente, als hätte er etwas an ihr entdeckt, und geht einen Schritt auf sie zu. Dann packt er seinen Geigenbogen wie einen Degen, schwingt ihn in Richtung Entenkopf und bringt ihn nur knapp neben Merles Ohrloch zu stehen. Der feine Luftzug streift ihr Gefieder und lässt sie zusammenzucken.
„Ha! Jetzt hab ich dich! …“, ruft der Graureiher, während sich seine schwarzen Pupillen schlagartig zusammenziehen. Erschrocken fasst sich Merle an die Schläfen: „Hä? Was? Wo?“, stammelt sie und rubbelt ihre Kopffedern.
Nadim nickt wissend, wie ein Arzt, der seine Patientin untersucht: „Ein ausgewachsener Tyrannicus.“
Merle glotzt geschockt: „Ein was?!“
„Na so ein fieser, mieser, kleiner Tyrannicus. Einer, der sich im Nacken festklammert und dir gemeine Dinge einflüstert. Hatte ich auch mal … einen von der ganz üblen Sorte!“
Merle verdreht entnervt die Augen: „Ha, ha, ha … So etwas gibt es doch gar nicht.“
„Selbstverständlich gibt es den“, widerspricht Nadim. „Wer würde dir denn sonst solche Gemeinheiten in den Kopf setzen?“
Im Laufe der Geschichte gelingt es Ente Merle immer besser, sich zu fragen, ob die Stimme des Tyrannicus ihr gut tut und ob seine Äußerungen der Realität entsprechen.
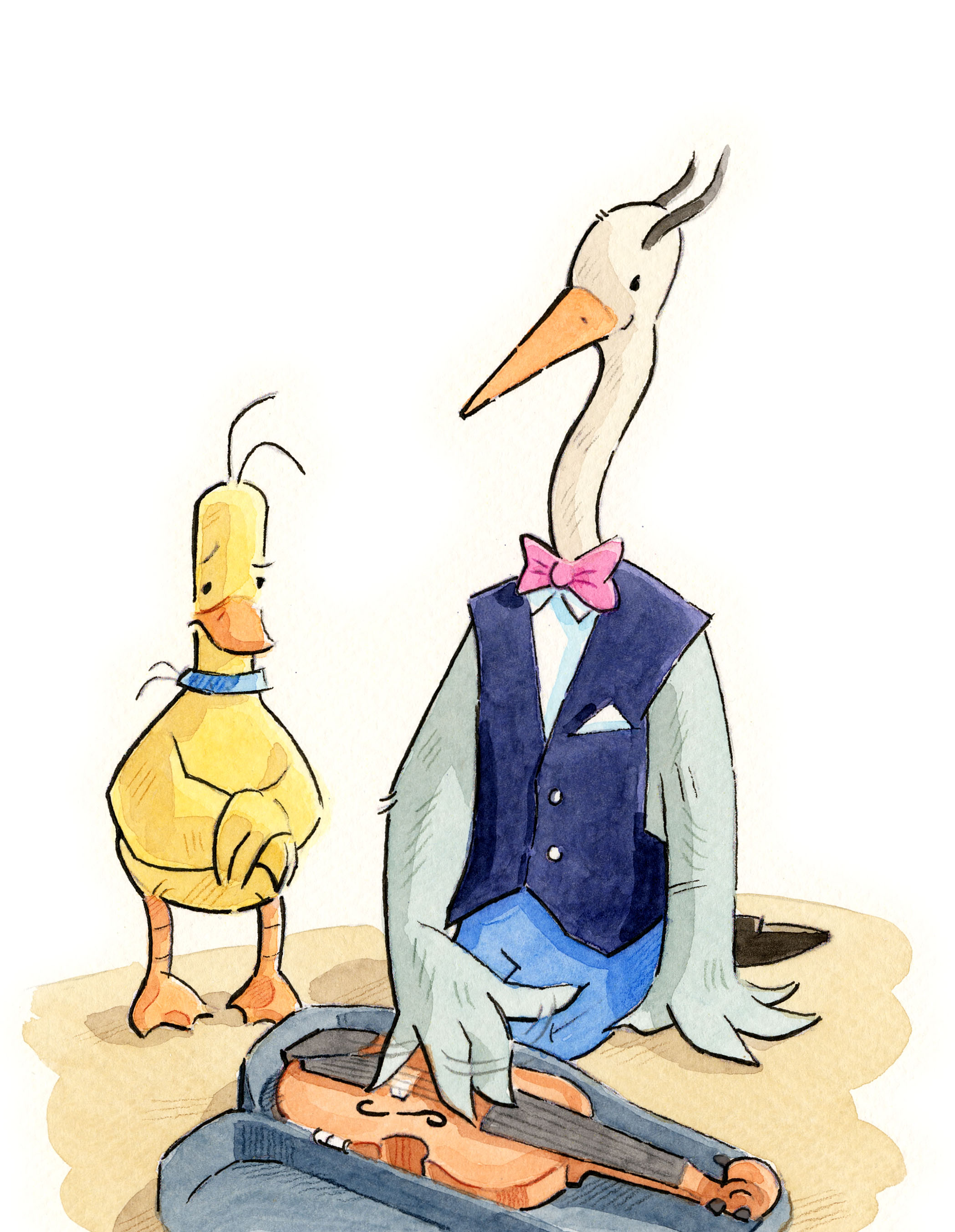
Erfolgstagebuch
Der Rückblick auf Gelungenes, positive Rückmeldungen und Erfolge kann dabei helfen, Hochstapler-Gefühle zu reduzieren.
Wer möchte, kann dazu ein Erfolgstagebuch anlegen.
Da Menschen mit Imposter-Tendenzen dazu neigen, Erfolge abzuwehren, in dem sie diese auf Glück, Zufall oder eine übertrieben positive Einschätzung von anderen zurückführen, ist es damit alleine nicht getan. Wichtig ist es, darüber zu reflektieren, wie man selbst zu diesen Erfolgen beigetragen hat.
Wenn das Kind die Erfolge abtut mit Sätzen wie „…da hatte ich Glück“ oder „…die Lehrerin war halt nett“, kann man nachfragen: „Hm… du denkst, du hattest Glück? Wie meinst du das genau? Wie hast du das durch Glück geschafft? Hast du bei diesem Mathe-Test einfach zufällig die richtigen Zahlen oder Formeln hingeschrieben? Welche anderen Erklärungen gäbe es noch?“
Mentoring und soziale Unterstützung
Der Kontakt zu anderen, erfahreneren Personen, die ihre Hochstapler-Tendenz überwunden haben, kann Einsamkeitsgefühle reduzieren, die Zuversicht wecken, dass Veränderungen möglich sind, und Zugang bieten zu hilfreichen Strategien und Gedanken.
Beispiel:
Der Graureiher sieht versonnen aus dem Fenster: „Als ich zur ersten Geige berufen wurde, wurde der Druck immer größer. Die übrigen Tiere im Orchester waren viel älter als ich. Einige der anderen Violinisten mochten mir meinen Platz nicht gönnen, ich hatte das Gefühl, mich jeden Tag beweisen zu müssen. Es war, als hätte ich eine innere Stimme im Kopf, die mir ständig einbläut: Du bist nicht gut genug! Du hast diesen Platz nicht verdient! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das andere merken. Du wirst dich blamieren. Was ist, wenn du dich verspielst? Und wenn du mitten auf der Bühne die Nerven verlierst? Ich habe mir diese Stimme immer wie einen grässlichen Wicht vorgestellt, der mir im Nacken sitzt. Ein Tyrannicus eben.“
Merle starrt Nadim fassungslos an: „Aber Sie waren doch so gut! Sie hatten doch nichts zu befürchten?“
Nadim legt seinen Kopf schief: „Ja, ich war gut. Aber egal, wie gut du bist: Du kannst immer fallen. Und mit einem Tyrannicus im Nacken ist nichts gut genug. Nie!“
Merle hält die Luft an. Ihr ist, als würde Nadim von ihr und ihren Sorgen erzählen.
Dabei wird oft deutlich: Kinder und Jugendliche mit Imposter-Syndrom gehen mit sich selbst sehr hart ins Gericht, sind anderen Menschen gegenüber aber meist sehr einfühlsam.
Der Kontakt zu anderen Betroffenen und das Mitgefühl, das sie ihnen entgegenbringen, macht es leichter, auch sich selbst mit mehr Freundlichkeit zu begegnen. Gleichzeitig stellen sie fest: Andere Personen machen sich ganz schön fertig, obwohl ich doch sehe, dass sie vieles können – ist das bei mir vielleicht auch so?
Weitere Strategien
Auch Achtsamkeitsübungen, ein Training in Selbstmitgefühl sowie weitere Methoden aus der Akzeptanz- und Commitmenttherapie haben sich im Umgang mit dem Imposter-Syndrom bewährt. Konkrete Übungen dazu finden sich im Anhang von „Du schaffst das, Merle!“
Buchtipp: "Du schaffst das, Merle!" - ein Mitmachbuch für junge Perfektionist/innen
Klicke auf das folgende Coverbild und gelange direkt zur Bestellmöglichkeit!
Ein Buch, das Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 12 Jahren dabei hilft:
- zu erkennen, dass ihr Wert als Mensch nicht von guten Noten oder Leistungen abhängt und sie sich Liebe nicht verdienen müssen.
- Fehler als Teil des Lernprozesses anzunehmen und gelassen mit ihnen umzugehen.
- den Mut und die Ausdauer zu entwickeln, um bei Schwierigkeiten am Ball zu bleiben, anstatt mit einem „Ich kann das nicht! Ich bin sowieso zu dumm!“ das Handtuch zu werfen.
- den Kreislauf aus unerbittlichen Leistungsansprüchen, Prüfungsängsten und Selbstkritik zu durchbrechen.